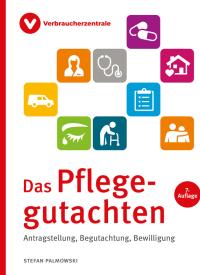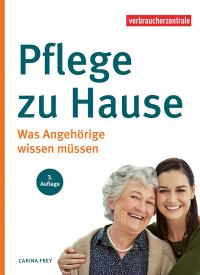Regelung des Selbstbehalts vor In-Kraft-Treten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes: Die Selbstbehaltssätze waren in den Unterhaltsleitlinien der jeweiligen Oberlandesgerichte festgeschrieben. Sie waren daher eindeutig und allseits anwendbar.
Regelung nach In-Kraft-Treten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes: Die Selbstbehalte passen nicht mehr. Daher gibt es keine konkrete Höhe. Die Düsseldorfer Tabelle regelt zum Selbstbehalt gegenüber den Eltern, dass dem Unterhaltspflichtigen der angemessene Eigenbedarf zu belassen ist, der unter Berücksichtigung des Zwecks und Rechtsgedanken des Angehörigen-Entlastungsgesetzes zu bemessen ist. Dies führt in der Praxis zu großen Unsicherheiten und unterschiedlichen Ergebnissen. Einige Oberlandesgerichte haben bei ihrer Berechnung die Jahresbruttogrenze von 100.000 Euro berücksichtigt. Sie haben aus dem ermittelten Nettoeinkommen von ca. 60.000 Euro einen Selbstbehaltssatz von 5.000 bis 5.500 Euro angenommen (für Eheleute 9.000 Euro).
Allerdings hat sich der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 23. Oktober 2024, Az. XII ZB 6/24 gegen diese Entscheidungen ausgesprochen. Der BGH lehnt ausdrücklich einen unmittelbaren Bezug auf den Grenzbetrag von 100.000 Euro im Zusammenhang mit der Bestimmung des Selbstbehaltes ab.
Für die Praxis bedeutet diese Entscheidung nun, dass die vom BGH entwickelten komplexen Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit in den Fällen des Elternunterhalts weiter anzuwenden sind, wenn das steuerliche Bruttoeinkommen eines Kindes den Grenzbetrag von 100.000 Euro übersteigt. Darüber hinaus sind nun alle Oberlandesgerichte aufgerufen, in ihren Leitlinien wieder einen Mindestselbstbehalt für den Elternunterhalt festzulegen, was bisher nur einzelne Oberlandesgerichte vorsehen.